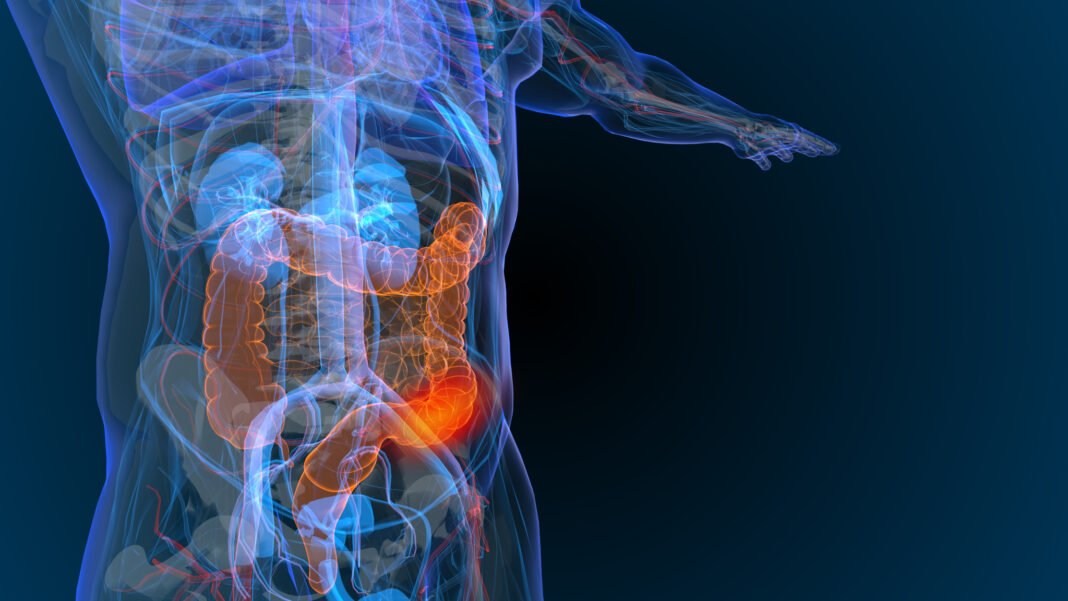Dr. Viorel Fetcu und Dr. Martin Vielhauer sprechen über Vorsorge, Diagnose und Therapie von Darmkrebs
Seit dem 1. April gibt es eine neue Regel zur Darmkrebs-Vorsorge: Die Krankenkassen zahlen eine Darmkrebs-Vorsorgeuntersuchung für Frauen und Männer bereits ab dem 50. Lebensjahr. Dr. Viorel Fetcu, Leiter des Darmzentrums Südwestfalen und Dr. Martin Vielhauer, Sektionsleiter Gastroenterologie in den GFO Kliniken Südwestfalen, sprechen im Interview über neuste Technologien und Erkenntnisse bei Diagnose und Behandlung von Darmkrebs. Dabei gehen sie auch auf die Bedeutung der Vorsorge ein.


Warum ist die Darmkrebsvorsorge so wichtig?
Dr. Vielhauer: Die Darmkrebsvorsorge ist so wichtig, weil jährlich circa 40.000 Menschen in Deutschland an Darmkrebs erkranken. Der Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung der Frau und die dritthäufigste Krebserkrankung des Mannes. Pro Jahr versterben circa 16.000 Patienten an den Folgen einer Darmkrebserkrankung.
Wie läuft die Untersuchung genau ab?
Dr. Vielhauer: Nach einer entsprechenden Darmvorbereitung am vorherigen Tag sowie am Tag der Untersuchung erfolgt die Untersuchung in der Regel mit einer intravenösen Beruhigungsmedikation, sodass sie vollkommen schmerzfrei abläuft. Die Endoskopie wird durch den Arzt sowie zwei Pflegekräften durchgeführt, wobei eine Assistenz die Überwachung des Patienten während der Untersuchung durchführt Die Untersuchungsdauer beträgt ca. 20 Minuten, Polypen können gleich bei der Spiegelung entfernt werden. Anschließend kann der Patient nach einer kurzen Nachüberwachung und einem Gespräch mit dem Arzt entlassen werden. Der Rest des Tages kann ohne Einschränkung – außer der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr – ganz normal verbracht werden. Beschwerden nach der Darmspiegelung treten in der Regel nicht auf – dennoch erhält der Patient eine Kontaktadresse um sich bei Problemen jederzeit melden zu können.
Kann künstliche Intelligenz dabei helfen, Darmkrebs besser oder früher zu erkennen
Die KI wird bereits heute in der Endoskopie genutzt, um während der Untersuchung auffällige Veränderungen an der Darmschleimhaut zu entdecken, die sonst dem Untersucher entgehen können. Diese Systeme sind in der Lage, eine zuverlässige feingewebliche Beurteilung zu erstellen.
Wie kann es gelingen, dass mehr Menschen regelmäßig zur Vorsorge gehen?
Dr. Vielhauer: Wir versuchen durch vermehrte Öffentlichkeitsarbeit auf die Wichtigkeit der Vorsorgekoloskopie aufmerksam zu machen. Die Anschreiben der gesetzlichen Krankenkassen an ihre Versicherten ab dem 50. Lebensjahr haben sicher einen wertvollen Dienst erwiesen. Gleichzeitig muss aber das ambulante Angebot zur Durchführung einer Darmspiegelung gerade in unserem ländlichen Raum deutlich verbessert werden.
Welche innovativen Technologien werden im Darmzentrum eingesetzt, um die Diagnose und Behandlung von Darmkrebs zu verbessern?
Dr. Fetcu: Die Diagnose von Darmkrebs steht und fällt mit der Darmspiegelung. Das ist der erste Schritt, um überhaupt eine Veränderung im Darm zu untersuchen. Normalerweise kommen die Patienten, zum Beispiel, wenn sie Blut im Stuhl haben oder ganz häufig wenn sie unregelmäßige Stuhlgänge haben oder wenn sich kurzfristig Durchfall und Verstopfung abwechseln. Dann sind mehrere Untersuchungen notwendig, aber die wichtigste ist die Darmspiegelung. Wenn etwas Auffälliges entdeckt wird und eine tumoröse Formation zu sehen ist, wird eine Probe entnommen. Diese wird dann zur Pathologie geschickt. Bevor die Patienten im Darmzentrum vorgestellt werden, ist noch eine CT-Untersuchung von Bauch und Brustkorb nötig, um zu schauen, ob der Tumor gestreut hat. Bei speziellen Karzinomen im Mastdarm sind noch eine MRT-Untersuchung und eine Endosonografie notwendig. Gerade die Endosonografie-Geräte sind heutzutage so gut, dass sie in manchen Fällen sogar besser sind als die MRT-Untersuchung. Darüber hinaus ist diese Untersuchung weniger belastend für die Patienten. Wenn wir alle Befunde haben, besprechen wir die Fälle im Darmzentrum. Dort wird eine individuelle Entscheidung getroffen, in welche Richtung es geht. Hier nehmen mehrere Abteilungen teil, es wird nach Leitlinien entschieden welche die beste Therapie für den Patienten ist. Zusätzlich werden die Tumormarker bestimmt, also diejenigen Stoffe, die über den Verlauf der Krankheit aussagekräftig sind. Bei uns werden CEA und CA19-9 bestimmt. Wir fangen jetzt damit an, weitere Tumormarker bereits vor der Operation in der Pathologie bestimmen zu lassen. Zuvor haben wir diesen Marker, MSI, erst nach der Operation bestimmt. Dadurch kann man sagen, ob der Patient eine Immuntherapie braucht oder nicht. Es gibt sehr viele Studien, die in diese Richtung gehen.
Wie wird das Behandlungsteam im Darmzentrum zusammengestellt?
Dr. Fetcu: Die ersten sind häufig die Gastroenterologen. Die untersuchen die Patienten und können sagen, ob etwas verdächtig aussieht. Die nächsten sind die Pathologen. Die sagen uns, ob es sich tatsächlich um ein Karzinom handelt oder nicht. Dann kommen die Radiologen mit den MRT- und CT-Untersuchungen. Die Endosonografie machen die Gastroenterologen. Dann kann man entscheiden, ob man die Patienten operieren muss oder nicht. Wenn es Metastasen gibt muss häufig zuerst eine Radiochemotherapie erfolgen. Dazu kommen die Bestrahlungstherapeuten und Onkologen. Wichtig ist auch die Psychoonkologie. Denn die Patienten sind schon belastet, wenn sie erfahren, dass sie ein Karzinom haben und eine lange Zeit behandelt werden müssen. Eine große Hilfe sind bei uns im Haus die onkologischen Fachpfleger. Die kümmern sich um die Patienten vom Anfang bis zum Ende der Therapie, begleiten sie nicht nur, sondern organisieren die Termine und nehmen Kontakt mit den Onkologen auf. Zusätzlich fangen wir nun an mit dem ERAS Programm, wo die Patienten schon präoperativ von unserem Pflegepersonal speziell vorbereitet werdem. Hier finden wir uns ganz am Anfang und ich möchte zurzeit nicht viel preisgeben, aber wir werden in Olpe den großen Kliniken ebenbürtig werden.
Gibt es personalisierte Behandlungspläne für Patienten, und wie werden diese erstellt?
Dr. Fetcu: Jeder Patient bekommt eine personalisierte Behandlung. Das hat etwas mit der Vorgeschichte der Patienten zu tun. Was haben die Patienten für Vorerkrankungen, können wir sie überhaupt onkologisch behandeln? Wurden sie schon einmal bestrahlt, wo wir sie bestrahlen wollen? Das dürfen wir dann nicht mehr. Stellen sie sich uns notfallmäßig oder geplant vor?
Jeder Patient ist einzigartig. Dazu kommen noch die Tumorformen. Der Pathologe sagt uns, wie groß der Tumor war, ob überhaupt Lymphknoten befallen sind, und, wenn ja: wie viele Lymphknoten. Ob es eine Fernmetastase gibt oder nicht. Alle diese Kriterien spielen eine ganz große Rolle in der Behandlung. Es gibt Leitlinien, das sind aber keine Richtlinien. Wir bewegen uns schon innerhalb der Leitlinien, aber manchmal muss man auch „Out-of-the-box“ denken und den Patienten andere Therapien empfehlen. Jeder Patient wird individuell behandelt.
Welche Lebensmittel senken das Darmkrebsrisiko?
Dr. Vielhauer: Grundsätzlich wird eine ballaststoffreiche Ernährung (30 g /Tag) empfohlen. Sie sollte reich an Folsäure, Kalzium und Vitamin D6 sein und viel Obst und Gemüse enthalten. Rotes bzw. verarbeitetes Fleisch sollte nicht täglich konsumiert werden.
Welche Rolle spielt die Ernährung bei der Behandlung von Darmkrebs, und gibt es spezielle Ernährungsprogramme für die Patienten?
Dr. Fetcu: Die Ernährung spielt eine ganz große Rolle, sowohl vor der Operation als auch danach. Egal, wie die Therapie aussieht: Die Patienten, bei denen Krebs diagnostiziert worden ist, bekommen über die onkologische Fachpflege ein Zusatz-Ernährungspaket. Damit können sie zuhause anfangen und dann werden sie behandelt. Sei es zuerst onkologisch und dann chirurgisch und bestrahlungstherapeutisch oder direkt chirurgisch. Dann haben sie ein deutlich besseres Ergebnis postoperativ. Die Wunden heilen besser und die Patienten sind postoperativ deutlich besser unterwegs. Nach der Operation werden sie weiter hochkalorisch ernährt, sodass alles besser heilen kann. So können auch unsere Anastomosen halten. Denn wenn sie keine Kalorien, keine Proteine haben, können sie auch nicht heilen. Hierbei ist unsere Ernährungsberaterin eine grosse Unterstützung.
Ein Patient mit einer großen Wunde hat den 5- bis 50-fachen kalorischen Bedarf wie andere Menschen. Wer eine Wunde hat muss sich proteinreicher ernähren.
Wie wird die Nachsorge von Darmkrebspatienten im Darmzentrum organisiert, um Rückfälle zu verhindern?
Dr. Fetcu: Die Nachsorge ist fest geregelt von der Deutschen Krebsgesellschaft. Ausschlaggebend sind die Tumorklassifikation und in welchem Stadium er sich befindet. Nach 3, 6, 9, 12 Monaten, einem, drei und fünf Jahren werden die Patienten untersucht. dabei wird alles kontrolliert: Tumormarker, wir machen einen Ultraschall, nach einem Jahr wird nochmal eine Darmspiegelung gemacht. Das wird alles regelhaft untersucht, oder wenn der Patient Beschwerden hat. Dann wird er sofort kontrolliert, mit bildgebenden Maßnahmen wie einem CT, um Rückfälle zu vermeiden. Und wenn ein Patient einen Rückfall hat, dann wird im Darmzentrum nochmal über den Fall diskutiert und zusammen eine individualisierte Entscheidung zur weiteren Behandlung getroffen.
Wie könnte die Darmkrebsvorsorge im Jahr 2050 aussehen?
Dr. Vielhauer: Derzeit werden sogenannte multitarget-stool-DNA Tests entwickelt, die eine sehr hohe Vorhersehbarkeit von Darmkrebs bzw. Darmpolypen an Stuhluntersuchungen versprechen. Wenn diese Tests also eine hohe Sicherheit erreichen, müssen nur die Patienten mit einem positiven Befund zur Darmspiegelung. Das würde natürlich die Akzeptanz der Darmkrebsvorsorge erheblich erhöhen – die dann zuerst als Stuhluntersuchung angeboten werden kann und eine entsprechende Sicherheit liefert, die derzeit bei den „ Stuhlbriefchen“ ( iFOBT) nicht gegeben ist.
Wenn es eine Checkliste für einen gesunden Darm gäbe, was müsste darauf stehen?
Dr. Vielhauer: Regelmäßige körperliche Bewegung.
Verzicht auf Tabak – sowie exzessiven Alkoholkonsum.
Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Personen.
Bewusste Ernährung.
Teilnahme an einer Vorsorgekoloskopie für Männer und Frauen ab dem 50. Lebensjahr.